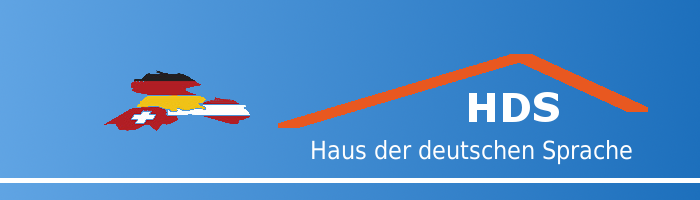Gedicht des Monats Juli 2008
Rainer Maria Rilke
Als Gedicht des Monats hat Hildegard D. in der Schweiz für Juli 2008 diese Verse von Rainer Maria Rilke vorgeschlagen:
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille –
und hört im Herzen auf zu sein.
Viele unserer Gäste sind diesem Gedicht schon begegnet. Manche können es sicher sogar auswendig. Es gehört zu den Juwelen deutscher Lyrik des frühen 20.Jahrhunderts.
Wer es aber hier zum ersten Mal gelesen hat, hat auch ohne den Titel des Gedichts erkannt, was Rilke beschreibt – ein an der unentrinnbaren Enge seines Käfigs leidendes Geschöpf.
Eine Überschrift hat das Gedicht durchaus, sogar eine recht präzise:
Der Panther
Im Jardin des Plantes, Paris
Dieser Jardin des Plantes, ein großer botanischer Garten mit naturkundlichen Instituten und zooartigen Gehegen, wurde kurz nach der französischen Revolution eingerichtet und ist noch heute im 5. Pariser Arrondissement zu besichtigen.
 Das Gedicht ist 1902 in Paris bei Rilkes erstem Besuch dort entstanden, entspringt also dem persönlichen Erleben des Dichters, und die sinnliche Intensität seiner eigenen Anschauung vermittelt er seinen Lesern in ihrer ganzen Stärke. Dieses Werk bedarf keiner Interpretation. Es wirkt unmittelbar, ist Wort für Wort und ohne Erläuterung verständlich.
Das Gedicht ist 1902 in Paris bei Rilkes erstem Besuch dort entstanden, entspringt also dem persönlichen Erleben des Dichters, und die sinnliche Intensität seiner eigenen Anschauung vermittelt er seinen Lesern in ihrer ganzen Stärke. Dieses Werk bedarf keiner Interpretation. Es wirkt unmittelbar, ist Wort für Wort und ohne Erläuterung verständlich.
Dreimal Stäbe in der ersten Strophe – mehr braucht der Dichter nicht, um uns Enge und Ausweglosigkeit bedrückend vor Augen zu führen. Der schwere Reim innerhalb des dritten Verses („…Stäbe gäbe…“) dramatisiert die Unentrinnbarkeit, das Gefangensein.
Die drei ersten Verse der zweiten Strophe lassen zunächst auch in dieser Szene noch Leben und Bewegung erhoffen. Der vierte Vers zerstört die Täuschung.
Einem ähnlichen Muster folgt die dritte Strophe: zuerst wieder ein Geschehen. Doch auch das endet im Nichts, hört auf zu sein.
Dieses Aufhören wird sinnenfällig durch die Nichtvollendung des letzten Verses. Die ersten elf hatten ausnahmslos fünf betonte Silben. Das Ohr des Lesers hat sich an diesen Takt gewöhnt und erschrickt, wenn nun – das abrupte Ende des beschriebenen Geschehens klanglich verstärkend – nach nur vier betonten Silben plötzlich ein Takt Schweigen, Leere eintritt.
Rilkes artistisches Reimvermögen – hundertmal in seinem umfangreichen lyrischen Werk zu bewundern – funkelt auch in diesem Gedicht, hier besonders in der vierten Strophe: Wie blass wäre „Augenlid“ gewesen, und wie bildstark ist der träge „Vorhang der Pupille“! Wo, im Gesamtbestand der deutschen Dichtung, hätten wir sonst noch das Wort „Pupille“? Das wahrlich Meisterhafte ist jedoch die „Stille“, die sich wie selbstverständlich als Reim auf diese ungewöhnliche Vokabel einstellt, so als hätte vom Sinn her hier gar kein anderes Wort zur Wahl gestanden.
(120 Jahre vor dem Paris-Besuch Rilkes hatte der von Goethe verehrte Wieland, selbst Vers-Dichter, in einem „Brief an einen jungen Dichter“ verraten: „Wenn […] der Reim sich immer von selbst, ohne dass man ihn kommen sah, an seinen Ort gestellt hat, […] so kann man sich sicher darauf verlassen, dass es dem Dichter, wie groß auch sein Talent seyn mag, unendliche Mühe gekostet hat.“)
Wie im Pariser „Panther“ beweist sich Rilke in folgendem Gedicht (wie in vielen weiteren) als Meister der anschaulichen, unprätentiösen Wiedergabe von Gesehenem, der vom Reim akzentuierten Beschreibung.
Römische Fontäne
Borghese
Zwei Becken, eins das andere übersteigend
aus einem alten runden Marmorrand,
und aus dem oberen Wasser leis sich neigend
zum Wasser, welches unten wartend stand,dem leise redenden entgegenschweigend
und heimlich, gleichsam in der hohlen Hand,
ihm Himmel hinter Grün und Dunkel zeigend
wie einen unbekannten Gegenstand;sich selber ruhig in der schönen Schale
verbreitend ohne Heimweh, Kreis aus Kreis,
nur manchmal träumerisch und tropfenweissich niederlassend an den Moosbehängen
zum letzten Spiegel, der sein Becken leis
von unten lächeln macht mit Übergängen.
Die Sätze fließen über das Reim-Ende der Verse hinweg in die nächste Zeile, in die darunter, dem Wasser gleich, das über den Rand der oberen Brunnenschale in die tiefere fällt. Was der Dichter mit Augen und Ohren erlebt hat, macht er auch uns in seinen Versen hörbar und sichtbar. – Die Unablässigkeit dieses Geschehens, das Ineinanderlaufen seiner einzelnen Phasen spiegelt sich auch darin, dass es in einen einzigen Satz gefasst ist. Und der wird nicht einmal durch ein Prädikat abgeschlossen: Der dargestellte Vorgang vollendet sich nie.
Ein schönes Beispiel für die sprachliche Verknüpfung von Hörbarem und Sichtbarem zum bildlichen Ausdruck einer übermächtigen Empfindung ist auch Rilkes berühmtes
Liebeslied
Wie soll ich meine Seele halten, daß
sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie
hinheben über dich zu andern Dingen?
Ach gerne möcht ich sie bei irgendwas
Verlorenem im Dunkel unterbringen
an einer fremden, stillen Stelle, die
nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen.
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
der aus zwei Saiten eine Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?
O süßes Lied.
(Einige Drucke haben, abweichend vom „Insel“-, also von Rilkes Haupt-Verlag, in der vorletzten Zeile „Spieler“ statt „Geiger“. Wir brauchen uns auf diesen Disput nicht einzulassen.)
Rilkes Leben (1875-1926) war von persönlicher und – damit – von örtlicher Unstetheit geprägt. Er wurde, wie sein Altersgenosse Franz Kafka, in eine deutschsprachige bürgerliche Familie des damals zweisprachigen Prag geboren. Versuche, eine Offiziers- oder eine Juristenlaufbahn einzuschlagen, scheiterten daran, dass er im Grunde seine ganze Begabung und Kraft, sein Leben der Dichtung widmen wollte. Schon 1894, ein Jahr vor seinem Abitur, erschien ein erstes Bändchen mit seinen Gedichten: „Leben und Lieder“.
Nach nur einem Studienjahr an der Prager Universität begann sein ruheloser Zug durch ganz Europa und Nordafrika: München, Berlin, Florenz, Wien, St. Petersburg, Worpswede, Paris, Rom, Kopenhagen, Dresden, Göttingen, Capri, Neapel, Ägypten, Algerien, Tunesien, Venedig, Madrid und wieder Paris. Im dritten Jahr des 1. Weltkriegs wurde er für einige Monate zum österreichischen Landsturm eingezogen, allerdings nicht aufs Schlachtfeld geschickt.
Die letzen Jahre seines Lebens verbrachte er bei immer schwächer werdender Gesundheit an verschiedenen Orten der Schweiz. Sein Grab findet man in Raron, etwa fünfzig Kilometer nördlich von Zermatt in den Walliser Alpen.
Die Inschrift auf seinem Grabstein hat der Dichter selbst festgelegt:
| ROSE, OH REINER WIDERSPRUCH. |
| LUST, |
| NIEMANDES SCHLAF ZU SEIN |
| UNTER SOVIEL |
| LIDERN. |
Lässt der Dichter der Nachwelt ein Rätsel zurück? Eine in wenige Worte gedrängte Mitteilung, die wir nicht entschlüsseln können? Oder sollen?
Spricht hier ein anderer Rilke als der der oben vorgestellten Gedichte? Nein, es ist derselbe. Aus allen Phasen seines Lebens haben wir neben den sich unmittelbar erschließenden, leuchtend klaren Gedichten und Prosawerken solche, die uns dunkel bleiben und nach dem Eingang suchen lassen.
Ein Gast des HDS verweist auf verschiedene Netzauftritte, die davon berichten, dass der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder zwei der oben genannten Gedichte Rilkes offenbar besonders schätzt. Bei seinem Antrittsbesuch 1998 in Paris hat er „Herbsttag“ auswendig vorgetragen und 2004 vor Studenten der Moskauer Finanzakademie den „Panther“.
Das HDS nimmt dies zum Anlass, seine Nachfolgerin, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, zu fragen, welches ihr deutsches Lieblingsgedicht sei.