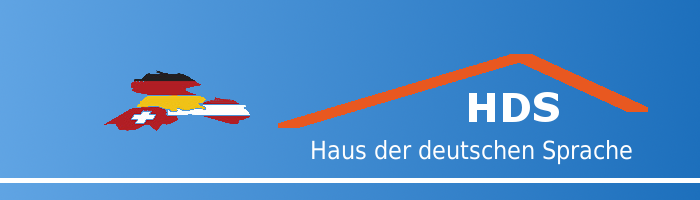Was Heinrich von Kleist uns heute noch zu sagen hat – Ein Beitrag zu seinem 200. Todesjahr
Von Hans-Jürgen Schmelzer
Als ich vor anderthalb Jahren daran ging, über Heinrich von Kleist zu schreiben, begab ich mich auf Recherche nach Marbach in das Literaturarchiv. Dabei stieß ich in den Karteien mehr zufällig auf einen uralten Aufsatz von mir selber mit der Überschrift „Der Zustand des Deutschunterrichts an den höheren Schulen“. Erschienen 1976 in einem 220 Seiten zählenden Werk, das der Freie Deutsche Autorenverband unter der Bezeichnung „Weißbuch zur Rettung der Sprache“ veröffentlicht hatte. Gemeint war freilich die deutsche Sprache – man wollte keine bösen Geister wecken. Dessen ungeachtet verstand sich die Schrift durchaus als Aufruf gegen Verhunzung der Muttersprache, Ausverkauf ihrer Sprachdenkmäler.
Mein Beitrag gliedert sich in Kapitel. Nummer 1 trägt den Titel Kleist schlägt Böll. Es war die Zeit, als man daran ging, die gymnasiale Oberstufe zu zertrümmern. Wie an der Universität boten die Deutschlehrer den Schülern Kurse an. Das, wie sie glaubten, mit unwiderstehlichem Lockfutter, also zeitgenössische Autoren, Gruppe 47, Brecht und Seghers. Ich selbst fiel deutlich ab: Meine Hausmannskost erstreckte sich auf Novellen aus Klassik, Romantik, beginnendes zwanzigstes Jahrhundert. Ergebnis: Während die Kollegen keine zehn Anmeldungen in ihre Listen übertrugen, drängelten sich über dreißig Schüler in meinen Kursraum – was meine Konkurrenten keineswegs vor Neid erblassen ließ, hatten sie doch entsprechend weniger Klausurkorrekturen zu bewältigen. Zu verdanken hatte ich den Zustrom nicht zuletzt Heinrich von Kleists „Michael Kohlhaas“.

Foto: Willi Wallroth (Wikimedia)
Der Dichter Kleist, soviel kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kommt bei jungen Menschen gut an. Mein eigener Deutschlehrer setzte sich damals aufs Pult und las uns Vierzehnjährigen „Das Bettelweib von Locarno“ vor. Er tat das so fantastisch, dass ich bis heute keinen Zweifel hege: Er hatte sich sorgfältig vorbereitet. Das Gespenstische dieser drangvollen, einen Edelmann wegen einer folgenschweren Gedankenlosigkeit in den Flammentod treibenden Horrorgeschichte durchrieselte uns Pubertierende, dass diese erste Begegnung nicht nur mir, auch Konabiturienten nach 50 Jahren noch im Gedächtnis geblieben ist. Entsprechend schulte ich mich selbst ganze Abende im lauten Lesen dieses zuchtvoll gewirkten, atemlosen Satzbaus. Dann trug ich vor: „Die Verlobung von St. Domingo“. „Mehr, mehr!“, schrieen die kaum Dreizehnjährigen. Die Stunde war zu Ende.
Michael Kohlhaas ist für Jugendliche auch im 200. Todesjahr seines Verfassers nicht nur spannend zu lesen, seine Problematik geht, seit die Welt für Tierschutz und artgerechte Tierhaltung sensibel geworden ist, jungen Seelen an die Nieren. Das erbarmungswürdig zerschundene Rappenpaar, das Junker Troncka dem „Hans Arsch“, wie er den Eigentümer apostrophiert, zurücklässt – das wahre Bild des Elends im Tierreiche! Mögen sich Berufsgermanisten noch so beeilen, des Rosshändlers Strafgericht gegen eine Staatsordnung, die die Schande gegen die wehrlose Kreatur noch deckt, als unangemessen einzustufen, dem jungen Leser von heute wird das nicht so schnell einleuchten. Der Zustand der zu lebenden Skeletten heruntergekommenen Rösser auf dem Dresdener Schlossplatz, von der Gelehrtenzunft wegen „offenbar gewordener Nichtigkeit des Rechtsfalles“ zum Tiefpunkt in Kohlhaas’ Laufbahn erklärt, dem Jugendlichen schreit solche Szene zum Himmel, zumal grobes Volk die für den Abdecker reifen Geschöpfe noch zur Zielscheibe öffentlichen Gespötts macht. Erlösend wirkte sich da die romantische Wende aus, die dem in Ketten Gelegten magische Kräfte zuführt, so dass er sich an den perfiden Machthabern doch noch weidlich rächen kann. Durch den verurteilten Tierschinder wieder dick gefüttert, sieht man am Schluss das von Wohlsein glänzende Gespann die Erde mit den Hufen stampfen. Das mag so manches junge Herz versöhnen. – Wieder liefert dieses sprachliche Kunstwerk den Beweis seiner Zeitlosigkeit, indem es jeder Epoche neue Deutungsansätze liefert. Damit überdauert es Millionen für den Tagesbedarf geschmiedeter Machwerke.
Ohne auch schon eine Zeile von ihm gekannt zu haben, war mir Heinrich von Kleist als Kind durchaus vertraut. Das lag an den sogenannten blauen Büchern meiner großen Schwester, wo ich diverse Dichter des 19. Jahrhunderts abgebildet fand. Kleist fiel mir durch das runde Kindergesicht in die Augen. Als ich erfahren musste, dieser Junge habe sich selbst getötet, blieb mein Gedächtnis für ihn wach bis in meine Gymnasialzeit.
Kleist ist mein Landsmann, ich wurde wie er in Frankfurt an der Oder geboren. Meine Eltern, bis 1945 Gutsbesitzer im Oderbruch, verkehrten mit Nachbarn, Verwandten, deren Namen im Leben des Dichters eine Rolle spielten: Massow, Pfuel, Burgsdorff, Kameke, Arnim. Er scheint in solchen Familien bis heutigentags nicht sonderlich angesehen. Hier treffen wir auf eine Achillesferse des Dichters selbst, der so gerne seiner Familie, einer der ersten des Staates Preußen, etwas bedeutet hätte, stattdessen daheim nur auf Unverständnis, Ablehnung, ja Ächtung stieß. Bitteschön – er hatte die einem Kleist einzig angemessene Militärkarriere nach sieben Dienstjahren aufgekündigt, auch das Studium geschmissen und es selbst im zivilen Leben zu keiner dauerhaften Anstellung gebracht.
Dichter sein? Im Nebenberuf ließ man das gelten, auch bei Kleists. Es hatte ja schon Onkel Ewald mit seinem Frühlingsepos den allseits anerkannten Hausdichter gestellt. Der aber hatte nie seine Uniform ausgezogen, ja, war für König Friedrich bei Kunersdorf als glorreicher Held gefallen. Um gegen ein solches Denkmal anzukommen, musste man als Poet schon Außergewöhnliches hervorbringen. Hier liegt der Stachel eines maßlosen Ehrgeizes, der den Sechsundzwanzigjährigen dazu trieb, sein Drama Robert Guiskard, mit dem er Goethe den Lorbeer vom Kopf reißen wollte, vor der Vollendung ins Feuer zu werfen, um daraufhin wie ein Wahnsinniger nur noch den Tod in Napoleons Schlachten zu suchen.
Meinem Großvater, selbst einer alten preußischen Soldatenfamilie entstammend, deren Name in Kleists letztem vollendetem Drama sogar eine Rolle spielt, schrieb ich als Halbwüchsiger Briefe nach Frankfurt, wo er unter den Schikanen des Ulbrichtregimes noch Jahre aushielt. Als ich ihm anvertraute, dass ich den Prinzen von Homburg lesen wolle, riet er mir scharf ab. Täglich käme er auf seinem Spaziergang an dem Denkmal dieses Schmachtjünglings vorbei, er empfahl mir als Lektüre Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“.
Doch gerade mit dem „Prinzen von Homburg“ kann man als Lehrer in der Oberstufe Erfolge erzielen. Umso leichter, wenn man ihm die Besprechung von Schillers „Maria Stuart“ und Goethes „Egmont“ vorangehen ließ. Wie der Prinz erwarten die schottische Königin und der niederländische Freiheitsheld die Hinrichtung, alle drei müssen mit der Todesangst fertig werden. Während Maria Halt im Glauben findet, Egmont im Bewusstsein, für die Freiheit zu sterben, Kraft schöpft, befällt den blutjungen erfolgsverwöhnten Reitergeneral nackte Panik, ihn gähnt das schwarze Nichts an. Das berührt zutiefst, weil es so unter die Haut gehend menschlich ist.
Kleist-Dichtungen liefern noch immer Stoff für lange uferferne Unterrichtsgespräche. Da sind die geächteten, um Würde und Mündigkeit kämpfenden Frauengestalten wie die im Kriegschaos vergewaltigte Marquise von O., die unschuldig vom Feuertod bedrohte Littegarde von Breda, das von ihrem Ritter unter dem Absatz behandelte Käthchen von Heilbronn, die von ihrem Gegner Achill beschämend hinters Licht geführte Penthesilea, die selbst durch einen Gott von ihrer Gattentreue nicht abzubringende Alkmene. Wir finden den ewigen Konflikt kleistscher Charaktere mit der Wirklichkeit, die so gar nichts gemein zu haben scheint mit dem, was sich der Mensch als unumstößlich wahr und wirklich vorstellt. Kohlhaas, der darüber zum Wüterich wird. Der einst so gütige Kaufmann Antonio Piachi, der, nachdem ihm sein Mündel zum Teufel wurde, selbst die Hölle sucht, um an dem ausgemachten Charakterschwein seinen Rachedurst zu stillen. Ein Jahrhunderterdbeben vernichtet Tausende, damit zwei Liebende glücklich wurden und doch der Todeskeule von Fanatikern nicht entgehen, just in dem Moment, wo sie ihrem Schöpfer für die Rettung danken wollen. Eine heilige Cäcilie, die durch ihr Musikwunder vier Chaoten nicht bekehrt, sondern bis ans Lebensende in den Wahnsinn treibt. Das sind kleistsche Wirklichkeiten, mit deren krasser Darstellung er seiner Zeit um Generationen voraus ist.
Was für ein Phänomen, dieser Heinrich von Kleist! Ein vom Leben gebeutelter, gehetzter, von Tiefschlägen geprügelter, namenlos unglücklicher Mensch schafft die vortrefflichste deutsche Komödie der Goethezeit! Dorfrichter Adam, dieser Großmeister in Sachen Schurkerei, Verstellung, Tücke, der sich der Unwissenheit eines unschuldigen Geschöpfes bedient, um es im Bett zu vernaschen. Angemaßte Amtsautorität, raffinierte Einschüchterungsmanöver, plumpe Angstmache, wie passt das alles in unsere Zeit, wo oft genug selbstherrliche Gelehr-samkeit mit Zahlenspielen, verfremdetem Sprachgebrauch Panik schürt, um Menschen für fadenscheinige Ziele gefügig zu machen. Volksnah, witzig, voll lederkrachender Komik wird Gerichtslärm um einen zerbrochenen Krug auf die Bühne gebracht. Die Genreszene eines holländischen Malers scheint zum Leben erwacht.
Mit der krassen Darstellung ist Kleist seiner Zeit um Generationen voraus.
Werfen wir zum Schluss einen Blick auf Kleists letztes Lebensjahr in Berlin, wenige Monate vor seinem Selbstmord am 21. November 1811 am Kleinen Wannsee. Ein ruheloses Dasein liegt hinter dem Vierunddreißigjährigen, das ihn auf unzähligen Reisen durch alle Teile Deutschlands, in die Schweiz, nach Norditalien und durch Frankreich trieb. Wer litt den Erfolglosen schon daheim? Nie ist es ihm vergönnt gewesen, einen geliebten Partner fürs Leben zu gewinnen. Die Verlobung mit Wilhelmine von Zenge löst er, weil er in der Schweiz Bauer werden will und sie ihm nicht dorthin folgen mag. Königin Luise, die mit einer kleinen Leibrente die Hand über ihn gehalten hat, ist überraschend gestorben. Er hat kein Einkommen, so dass man kaum weiß, wovon er existiert hat. Er liegt, um Feuerung zu sparen, ganze Tage im Bett und dichtet, oder er sucht eine billige Kneipe auf, daselbst Novellen entwerfend, die man als Gipfelpunkt deutscher Prosa bewundern wird. Ein Verleger namens Reimer gibt noch zu Kleists Lebzeiten zwei Erzählbände heraus, zahlt ihm dafür einen Hungerlohn. Sieben fertige Dramen hat der bedeutendste deutsche Theaterschriftsteller neben Schiller vorzuweisen. Das Berliner Nationaltheater nimmt keine Notiz davon. Der Homburger Prinz, sein letzter Wurf, ein vaterländisches Stück, sollte dem Herrscherhaus alle Ehre machen. Der König empfindet es als Provokation, wird noch Jahre nach des Dichters Tod die Aufführung verbieten.
Kleist ist eine journalistische Naturbegabung. Noch gibt er nicht auf und wagt sozusagen sein letztes Ding: die Herausgabe einer neuen Zeitung – der Berliner Abendblätter. Sie machen schon deswegen Epoche, weil sie als erste Berliner Zeitung jeden Wochentag erscheinen. Der An-sturm auf das erste Massenblatt in der Geschichte der deutschen Journalistik ist riesig. Ein rei-ßender Absatzmarkt tut sich dem staunenden Gründer auf. Doch nur kurz. Allzu schnell sperrt die Regierung dem Blatt den Zufluss neuester Polizeiberichte, nach der die Käufer nur so gieren. Die Leser springen ab, die Zeitung geht ein, zurück bleiben Schulden. Er fährt noch einmal nach Hause, wo man ihn wegen seines abgerissenen Äußeren kaum wiedererkennt. Doch statt Beistand zu leisten, übergießt man ihn mit bitteren Vorwürfen, so als habe er im ganzen Leben noch nichts zuwege gebracht. Das gibt ihm den Rest. Er reist nach Berlin zurück, wo er sich mit einer schwerkranken, lebensmüden Frau zusammengetan hat. Sie verbringen eine Nacht in einem Ausflugslokal des Berliner Stadtrandes, am folgenden Morgen erklimmen sie, mit Rum und Wein aufgeheitert, eine kleine Höhe. Kleist zückt seine Pistole, erschießt erst die Frau, dann sich selber. Noch Jahrzehnte werden Hof, Adel, eigene Familie daran zu kauen haben, dass der doppelte Todesschütze, ein verabschiedeter Soldat, statt fürs Vaterland zu fallen, sich selbst das Leben genommen hat. Kein Geistlicher hat ihn (zur letzten Ruhe) begleitet – so ging es auch dem jungen Werther.
Beitrag aus VDS-Sprachnachrichten, Nr. 51 September 2011