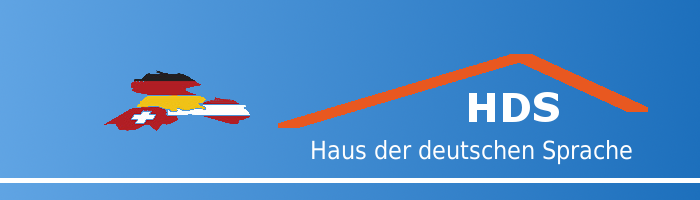Gedicht des Monats August 2008
Als HDS-Gedicht des Monats (August 2008) hat Erika Oe. aus Stendal das folgende vorgeschlagen:
Am Turme
Ich steh‘ auf hohem Balkone am Turm,
Umstrichen vom schreienden Stare,
Und lass‘ gleich einer Mänade* den Sturm
Mir wühlen im flatternden Haare;
O wilder Geselle, o toller Fant**,
Ich möchte dich kräftig umschlingen,
Und, Sehne an Sehne, zwei Schritte vom Rand
Auf Tod und Leben dann ringen!Und drunten seh‘ ich am Strand, so frisch
Wie spielende Doggen, die Wellen
Sich tummeln rings mit Geklaff und Gezisch,
Und glänzende Flocken schnellen.
O, springen möcht‘ ich hinein alsbald,
Recht in die tobende Meute,
Und jagen durch den korallenen Wald
Das Walroß, die lustige Beute!Und drüben seh ich ein Wimpel wehn
So keck wie eine Standarte***,
Seh auf und nieder den Kiel sich drehn
Von meiner luftigen Warte;
O, sitzen möcht‘ ich im kämpfenden Schiff,
Das Steuerruder ergreifen,
Und zischend über das brandende Riff
Wie eine Seemöve streifen.Wär‘ ich ein Jäger auf freier Flur,
Ein Stück nur von einem Soldaten,
Wär‘ ich ein Mann doch mindestens nur,
So würde der Himmel mir raten****;
Nun muß ich sitzen so fein und klar,
Gleich einem artigen Kinde,
Und darf nur heimlich lösen mein Haar,
Und lassen es flattern im Winde!* rasende Begleiterin des griech. Weingottes Dionysios
** Kerl, *** Fahne, **** mich mit Rat unterstützen
Wer dieses Gedicht in einem Buch findet, weiß es von vornherein, wer ihm aber erstmals hier begegnet, erfährt es erst im sechstletzten Vers: Hier spricht eine Frau. Über sich selbst. Über sich als Frau.
 Die Autorin ist Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848), die vielleicht bis heute bedeutendste Dichterin deutscher Sprache, auf jeden Fall die erste, die ein umfangreiches, alle Gattungen umfassendes Werk geschaffen hat (Gedichte, Erzählendes und Dramentexte).
Die Autorin ist Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848), die vielleicht bis heute bedeutendste Dichterin deutscher Sprache, auf jeden Fall die erste, die ein umfangreiches, alle Gattungen umfassendes Werk geschaffen hat (Gedichte, Erzählendes und Dramentexte).
Sie stammte aus westfälischem Adel des Münsterlandes und erfuhr die damals in diesen Kreisen übliche Ausbildung „höherer Töchter“ – Literatur, Fremdsprachen, Musik. Damit, dass sie sich selbst – noch keine zwölf Jahre alt – an eigene literarische Versuche wagte, wusste ihre Familie nicht recht etwas anzufangen.
Im dramatischen Fragment „Bertha“ lässt die erst sechzehnjährige Dichterin ihre Titelfigur sagen:
Wenn Weiber über ihre Sphäre steigen,
Entfliehn sie ihrem eignen bessern Selbst.
Sie möchten aufwärts sich zur Sonne schwingen
Und mir dem Aar* durch duftge Wolken dringen
Und stehn allein im nebelichten Tal.
* Adler
Ist „Am Turme“, das Gedicht der inzwischen fast Fünfundvierzigjährigen, ein Protest gegen die (von der Natur, von der damaligen Gesellschaft?) bestimmte Stellung der Frau, an die sie selbst als junges Mädchen – ein wenig altklug – erinnert hatte?
Oder kritisiert Droste-Hülshoff diese Rollenzuteilung hier gar nicht? War das 1842, als sie das Gedicht schrieb, überhaupt schon ein öffentlich abzuhandelndes Thema?
Es ist die Klage der Dichterin „nur“ darüber, dass sie eben kein Mann ist und deshalb nicht tun kann, wovon sie schwärmend träumt. Doch zunächst ist es noch nicht einmal eine Klage. Drei Strophen lang lässt das sprechende Ich seiner feurigen Phantasie freien Lauf. Vom „hohen Balkone am Turm“, aus der Ferne also, betrachtet es Szenen kraftvollen, abenteuerlichen Lebens. Und dreimal, immer in der Mitte der Strophe, will es sich und seinen Tatendrang in dieses bunte Leben stürzen, möchte aktiv mitmachen: „O … ich möchte / möchte ich“. Von Mann oder Frau ist noch gar nicht die Rede.
Doch dann die vierte Strophe! Wie schon die ersten drei gliedert auch sie sich in zwei Teile, zerbricht geradezu. „Wär ich“, „wär ich“, „würde“ – die Irrealität zeigt sich schon in der grammatischen Form: Hier spricht – jetzt erst erfährt es der Leser – kein Jäger, kein Soldat, nicht einmal ein „Mann doch mindestens“.
So hat jetzt an die Stelle des jauchzenden „O“ in den ersten drei Strophen das resignierende „nun muss ich“ der Realität zu treten. Von genialer bildlicher Kraft ist dieser Kontrast zwischen dem vom Sturm durchwühlten Haar der Mänade zu Beginn und den am Ende heimlich für den Wind gelösten Haaren des artigen Kindes.
Über den Schmerz, der solchem Kontrast von Traum und Wirklichkeit innewohnen kann, hatte schon vierzig Jahre vor Drostes bewegtem Gedicht eine andere, heute kaum noch bekannte Dichterin geklagt – Karoline von Günderode (1780-1806):
Der Kuß im Traume,
aus einem ungedruckten RomaneEs hat ein Kuß mir Leben eingehaucht,
Gestillet meines Busens tiefstes Schmachten,
Komm, Dunkelheit! mich traulich zu umnachten,
Daß neue Wonne meine Lippe saugt.In Träume war solch Leben eingetaucht,
Drum leb‘ ich, ewig Träume zu betrachten,
Kann aller andern Freuden Glanz verachten
Weil nur die Nacht so süßen Balsam haucht.Der Tag ist karg an liebesüßen Wonnen,
Es schmerzt mich seines Lichtes eitles Prangen
Und mich verzehren seiner Sonne Gluthen.
Drum birg* dich Aug‘ dem Glanze irrd’scher Sonnen!
Hüll‘ dich in Nacht, sie stillet dein Verlangen
Und heilt den Schmerz, wie Lethes** kühle Fluthen.* verschließ dich dem Glanze, ** Fluss des Vergessens in der altgriech. Unterwelt
Neben vielen betrachtenden, oft über sich selbst sinnierenden Gedichten, wie z.B. An meine Mutter (siehe Gedicht des Monats Mai 2008), hat uns Droste-Hülshoff eine große Zahl erzählender, oft dramatischer Gedichte und Balladen hinterlassen. Auch hier kann der Kontrast von Einbildung und Wirklichkeit dramatisch wirken. Am bekanntesten ist vielleicht die (etwa zur selben Zeit wie „Am Turme“ entstandene) gruselige Erzählung
Der Knabe im Moor
|
Voran, voran! nur immer im Lauf, Voran, als woll‘ es ihn holen; Vor seinem Fuße brodelt es auf, Es pfeift ihm unter den Sohlen Wie eine gespenstige Melodei; Das ist der Geigemann ungetreu, Das ist der diebische Fiedler Knauf, Der den Hochzeitheller gestohlen! |
Da birst das Moor, ein Seufzer geht
Hervor aus der klaffenden Höhle;
Weh, weh, da ruft die verdammte Margret:
»Ho, ho, meine arme Seele!«
Der Knabe springt wie ein wundes Reh;
Wär‘ nicht Schutzengel in seiner Näh‘,
Seine bleichenden Knöchelchen fände spät
Ein Gräber im Moorgeschwehle.
Da mählich gründet der Boden sich,
Und drüben, neben der Weide,
Die Lampe flimmert so heimatlich,
Der Knabe steht an der Scheide.
Tief atmet er auf, zum Moor zurück
Noch immer wirft er den scheuen Blick:
Ja, im Geröhre war’s fürchterlich,
O schaurig war’s in der Heide!
 Zwischen dem anfänglichen „O schaurig ist’s’“ und dem erleichterten „O schaurig war’s“ am Ende erzittern Knabe und Leser vor dem ganzen Grusel-Arsenal, das so ein nächtliches Moor für die verängstigte Phantasie bereithält. In raffiniert kurzen Anspielungen wird noch alles menschlich Böse und Dämonische zitiert, das in der kollektiven Erinnerung der ländlichen Gemeinde geisternd fortlebt und nun den armen Knaben bedroht und jagt. „Die unselige Spinnerin“, „der Geigemann ungetreu“, „die verdammte Margret“ – der Leser kennt diese finsteren Gestalten nicht, aber unheimlich werden sie auch ihm. Und auch der Leser beruhigt sich, wenn sich der Boden unter den Füßen wieder „mählich gründet“ und neben der Weide die heimatlich flimmernde Lampe sichtbar wird. Es ist alles noch mal gut gegangen – Einbildung und Realität.
Zwischen dem anfänglichen „O schaurig ist’s’“ und dem erleichterten „O schaurig war’s“ am Ende erzittern Knabe und Leser vor dem ganzen Grusel-Arsenal, das so ein nächtliches Moor für die verängstigte Phantasie bereithält. In raffiniert kurzen Anspielungen wird noch alles menschlich Böse und Dämonische zitiert, das in der kollektiven Erinnerung der ländlichen Gemeinde geisternd fortlebt und nun den armen Knaben bedroht und jagt. „Die unselige Spinnerin“, „der Geigemann ungetreu“, „die verdammte Margret“ – der Leser kennt diese finsteren Gestalten nicht, aber unheimlich werden sie auch ihm. Und auch der Leser beruhigt sich, wenn sich der Boden unter den Füßen wieder „mählich gründet“ und neben der Weide die heimatlich flimmernde Lampe sichtbar wird. Es ist alles noch mal gut gegangen – Einbildung und Realität.
Von dunklen Ahnungen, Dämonie, Irrtum und wirklichem Verbrechen handelt auch Drostes berühmtestes Prosawerk „Die Judenbuche“. Die nur etwa 50 Seiten lange Kriminalerzählung berichtet in schnörkelloser, nüchterner Prosa von einem rätselhaften Mordfall, der eine Gemeinde für lange Zeit beschäftigt und sich am Ende auf überraschende Weise aufklärt.
Das HDS empfiehlt „Die Judenbuche“ allen Krimifreunden. Der Text ist für 2,10 Euro als Reclam-Heftchen (ISBN: 978-3150018583) erhältlich. Seine Lektüre dauert nicht länger als ein „Tatort“ und ist mindest genauso spannend.