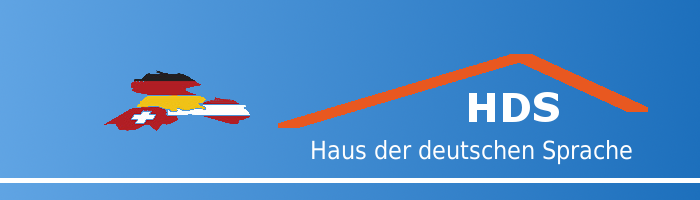Gedicht des Monats Oktober 2009
Gemäht sind die Felder, der Stoppelwind weht,
hoch droben in Lüften mein Drachen nun steht,
die Rippen von Holze, der Leib von Papier,
zwei Ohren, ein Schwänzlein sind all seine Zier;
und ich denk: so drauf liegen im sonnigen Strahl,
ach, wer das doch könnte nur ein einziges Mal!Da guckt‘ ich dem Storch in das Sommernest dort:
Guten Morgen, Frau Storchen, geht die Reise bald fort?
Ich blickt‘ in die Häuser zum Schornstein hinein:
O Vater und Mutter, wie seid ihr so klein.
Tief unter mir säh‘ ich Fluss, Hügel und Tal.
Ach, wer das doch könnte nur ein einziges Mal!Und droben, gehoben auf schwindelnder Bahn,
da fasst ich die Wolken, die segelnden, an;
ich ließ’ mich besuchen von Schwalben und Krähn,
und könnte die Lerchen, die singenden, sehn;
die Englein belauscht‘ ich im himmlischen Saal,
Ach, wer das doch könnte nur ein einziges Mal!
Das Wort “Herbst“ braucht der Dichter dieser Verse nicht. Er zeigt ihn einfach. Die Ernte ist eingebracht, der Drachen fliegt, die Störche wollen in den Süden ziehen. Die sinnliche Erfahrung der Jahreszeit gibt ein einziges, beherzt zusammengefügtes Wort wieder: Stoppelwind. Das mache eine andere Sprache der deutschen erst einmal nach!
 Wer hier so virtuos mit der Sprache umgeht, sanft und zugleich kraftvoll vorandrängend, ist Victor Blüthgen. Er ist 1844 in Zörbig geboren, einer kleinen Stadt auf etwa halbem Wege zwischen Leipzig und Magdeburg, und 1920 in Berlin gestorben. Vom Studium her war er evangelischer Theologe, arbeitete aber den größten Teil seines Lebens als Journalist bei verschiedenen Zeitschriften, unter anderem bei der jahrzehntelang gut verbreiteten, bürgerlichen “Gartenlaube“. Daneben war er stets auch als freier Schriftsteller in allen denkbaren literarischen Gattungen produktiv. Besonders gern schrieb er Gedichte und Erzählungen für Kinder (eine Probe finden Sie hier).
Wer hier so virtuos mit der Sprache umgeht, sanft und zugleich kraftvoll vorandrängend, ist Victor Blüthgen. Er ist 1844 in Zörbig geboren, einer kleinen Stadt auf etwa halbem Wege zwischen Leipzig und Magdeburg, und 1920 in Berlin gestorben. Vom Studium her war er evangelischer Theologe, arbeitete aber den größten Teil seines Lebens als Journalist bei verschiedenen Zeitschriften, unter anderem bei der jahrzehntelang gut verbreiteten, bürgerlichen “Gartenlaube“. Daneben war er stets auch als freier Schriftsteller in allen denkbaren literarischen Gattungen produktiv. Besonders gern schrieb er Gedichte und Erzählungen für Kinder (eine Probe finden Sie hier).
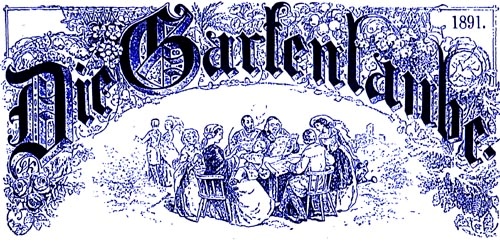 Sein Ruhm hat ihn nicht lang überlebt. In den Bibliotheken und Buchhandlungen sucht man heute meist vergeblich nach seinen Texten. Stand im zweiten Vers des Originals Drache oder Drachen? Hieß es in der zweiten Strophe ursprünglich Frau Störchin, Frau Storchen oder Frau Storchin? Warum und wann hat der Dichter das “c“ in seinem Vornamen in ein “k“ verwandelt?
Sein Ruhm hat ihn nicht lang überlebt. In den Bibliotheken und Buchhandlungen sucht man heute meist vergeblich nach seinen Texten. Stand im zweiten Vers des Originals Drache oder Drachen? Hieß es in der zweiten Strophe ursprünglich Frau Störchin, Frau Storchen oder Frau Storchin? Warum und wann hat der Dichter das “c“ in seinem Vornamen in ein “k“ verwandelt?
Die Antworten findet man sicherlich beim Heimat-Verein Zörbig e.V. Doch sie sind nicht so wichtig. Klar ist hingegen: Dieses Gedicht bleibt. Das Internet hat ihm neue Bekanntschaft und neue Bewunderer verschafft. – Das HDS dankt Herrn F. B. in Hamburg für den jahreszeitlich passenden Hinweis auf dieses Herbstgedicht.
Der Frühling und der Sommer – wen wundert es? – haben die Dichter (und nicht nur die deutschsprachigen) schon immer inspiriert (vgl. Gedicht des Monats Juli 2009). Mit diesen beiden Jahreszeiten verbinden sich einfach gute Gefühle. Sie erlauben helle, lebendige Bilder.

Der Herbst aber hat mehrere Gesichter.
Eines ist die Vollendung des Sommers, die Reife, die Ernte. Der Winter kann kommen, die Scheunen, Speisekammern und Regale der Supermärkte sind gefüllt.
 |
 |
Friedrich Hebbel (1813-1863):
HERBSTBILD
| Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! Die Luft ist still, als atmete man kaum, Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, Die schönsten Früchte ab von jedem Baum. |
O stört sie nicht, die Feier der Natur! Dies ist die Lese, die sie selber hält, Denn heute löst sich von den Zweigen nur, Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. |

Auch der sonst sprachlich oft dunkle Friedrich Hölderlin (1770-1843) preist die goldene Pracht des Herbstes in einem “hellen Bild“:
DER HERBST
Das Glänzen der Natur ist höheres Erscheinen,
Wo sich der Tag mit vielen Freuden endet,
Es ist das Jahr, das sich mit Pracht vollendet,
Wo Früchte sich mit frohem Glanz vereinen.
Das Erdenrund ist so geschmückt, und selten lärmet
Der Schall durchs offne Feld, die Sonne wärmet
Den Tag des Herbstes mild, die Felder stehen
Als eine Aussicht weit, die Lüfte wehen
Die Zweig und Äste durch mit frohem Rauschen,
Wenn schon mit Leere sich die Felder dann vertauschen,
Der ganze Sinn des hellen Bildes lebet
Als wie ein Bild, das goldne Pracht umschwebet.
Der frühvollendete österreichische Lyriker Georg Trakl (1887-1914) hat seine Freude am reichen Höhepunkt und zugleich stillen Ausklang des Jahreslaufs.
Verklärter Herbst
| Gewaltig endet so das Jahr Mit goldnem Wein und Frucht der Gärten. Rund schweigen Wälder wunderbar Und sind des Einsamen Gefährten. |
Da sagt der Landmann: Es ist gut. Ihr Abendglocken lang und leise Gebt noch zum Ende frohen Mut. Ein Vogelzug grüßt auf der Reise. |
Es ist der Liebe milde Zeit.
Im Kahn den blauen Fluß hinunter
Wie schön sich Bild an Bildchen reiht –
Das geht in Ruh und Schweigen unter.
In seinem Gedicht FÜLLE besingt auch der Schweizer Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898) den Reichtum, die Früchte des Herbstes, doch
Genug ist nicht genug! Gepriesen werde
Der Herbst! Kein Ast, der seiner Frucht entbehrte!
Tief beugt sich mancher allzu reich beschwerte,
Der Apfel fällt mit dumpfem Laut zur Erde.
Genug ist nicht genug ! Es lacht im Laube!
Die saftge Pfirsche winkt dem durstgen Munde!
Die trunknen Wespen summen in die Runde:
„Genug ist nicht genug !“ um eine Traube.
Genug ist nicht genug ! Mit vollen Zügen
Schlürft Dichtergeist am Borne *) des Genusses,
Das Herz, auch es bedarf des Überflusses,
Genug kann nie und nimmermehr genügen!
*) Brunnen, Quelle
Ein Jahrhundert früher hatte ein anderer Schweizer, Johann Gaudenz von Salis-Seewis (1762-1834), das Leben zu dieser Jahreszeit in prallen Farben bejubelt. Die “grauen“ Nebel (Vers 5) muss er zwar zur Kenntnis nehmen, doch umso kräftiger leuchten sein Bunt, Gelb, Rot, Golden, Weiß, Purpur. (Raffiniert, wie der Dichter die gestreiften Pfirsiche, im Herbst ja längst geerntet, noch mit ins Bild holt. Er lässt sie auf dem Geländer nachreifen.)
HERBSTLIED
| Bunt sind schon die Wälder, Gelb die Stoppelfelder, Und der Herbst beginnt. Rote Blätter fallen, Graue Nebel wallen, Kühler weht der Wind. |
Flinke Träger springen, Und die Mädchen singen, Alles jubelt froh! Bunte Bänder schweben Zwischen hohen Reben Auf dem Hut von Stroh. |
|||
| Sieh, wie hier die Dirne Emsig Pflaum’ und Birne In ihr Körbchen legt! Dort mit leichten Schritten Jene goldne Quitten In den Landhof trägt! |
Geige tönt und Flöte Bei der Abendröte Und im Mondenglanz. Junge Winzerinnen Winken und beginnen Deutschen Ringeltanz. |
|||
| Wie die volle Traube Aus dem Rebenlaube Purpurfarbig strahlt! Am Geländer reifen Pfirsiche, mit Streifen Rot und weiss bemalt. |
 |
|||
Das andere Gesicht des Herbstes: Unser Schatz bildlicher Redewendungen kennt den „goldenen Oktober“, aber auch den „Herbst des Lebens“. Die dritte Jahreszeit vollendet den Sommer und führt uns zugleich unerbittlich in den Winter hinein. So wundert es nicht, dass das Erleben des Herbstes die Dichter oft melancholisch stimmt. Oder glauben sie, umgekehrt, dem Leser eine dunkle Stimmung vor der Kulisse des Herbstes besser vermitteln zu können – die betrübte Erinnerung an verlorene, schönere Zeiten, die Einsamkeit, das nahende Ende? Das frohe Erntedankfest und der Friedhofs-Tag Allerseelen folgen sich im Kirchenjahr, gewiss nicht zufällig – im Herbst eben und mit nur kurzem zeitlichen Abstand.
Den raschen Übergang von der einen Stimmung zur anderen hat Rainer Maria Rilke (1875-1926) in seinem berühmten Gedicht HERBSTTAG meisterhaft dargestellt:
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg’ deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Dieses “ja, aber“ bestimmt die Herbstgefühle auch des Wiener Dichters Ferdinand von Saar (1833-1906):
Herbst
| Der du die Wälder färbst, Sonniger, milder Herbst, Schöner als Rosenblüh’n Dünkt mir dein sanftes Glüh’n. |
Aber vernehmbar auch Klaget ein scheuer Hauch, Der durch die Blätter weht: Daß es zu Ende geht. |
||
| Nimmermehr Sturm und Drang, Nimmermehr Sehnsuchtsklang; Leise nur athmest du Tiefer Erfüllung Ruh‘. |
 |
Auch Gottfried Benn (1886-1956), der Berliner Arzt und Lyriker, sieht in seinem Gedicht ASTERN den Herbst als die Zeit des Umbruchs, des Blicks zurück, wo es kein Zurück mehr gibt. Wie der Autor unseres Gedichts des Monats (siehe oben) braucht auch er nicht “Herbst“ zu sagen. Denn nichts anderes kann “Astern“ bedeuten.
Astern
| Astern – schwälende Tage, alte Beschwörung, Bann, die Götter halten die Waage eine zögernde Stunde an.Noch einmal die goldenen Herden, der Himmel, das Licht, der Flor, was brütet das alte Werden unter den sterbenden Flügeln vor? |
Noch einmal das Ersehnte, den Rausch, der Rosen Du – der Sommer stand und lehnte und sah den Schwalben zu,Noch einmal ein Vermuten, wo längst Gewissheit wacht: Die Schwalben streifen die Fluten und trinken Fahrt und Nacht. |
*) “schwälen“ findet sich in keinem Wörterbuch, hat aber hier, von Benn aus schwelen und quälen kombiniert (?), klangbildliche Ausdruckskraft.
Aus: Gottfried Benn, Statische Gedichte, hg. von Paul Raabe, © 1948, 2006 by Arche Literatur Verlag AG, Zürich-Hamburg
Vergangenes, Verlorenes, scheidendes Licht und Kälte gehen in dem Gedicht von Stefan George (1868-1933) ineinander über:
 Wenn die Blätter gelblich werden
Wenn die Blätter gelblich werden
Und der kühle Wind sie bricht
Schwach und schwächer stets auf Erden
Nieder strahlt der Sonne Licht:
Hören auch die Herzen wieder
Auf des Wechsels ewigen Ruf
Blumen, Blätter sinken nieder
Die der Lenz in ihnen schuf.
Was zu Hoffnung und zu Wonne
Weckte Sommer-Sonnenstrahl
Schwindet vor der Wintersonne
Und wir trauern kalt und kahl.
Allmählich wird deutlich: Eigentlich will oder kann keiner der Dichter seine nachdenklichen, traurigen oder düsteren Vorstellungen vom Herbst (oder im Herbst) anschaulich wiedergeben, wenn er sie nicht irgendwie als Kontrast zu Erfreulicherem aus früheren Jahres- oder Lebenszeiten darstellt. Ein weiteres schönes Beispiel dafür ist ALLERSEELEN von Hermann von Gilm zu Rosenegg (1812-1864), einem Autor, der eigentlich nur in einem, freilich einem großen Gedicht weiterlebt:
ALLERSEELEN
Stell‘ auf den Tisch die duftenden Reseden,
Die letzten roten Astern trag herbei
Und laß uns wieder von der Liebe reden,
Wie einst im Mai.Gib mir die Hand, daß ich sie heimlich drücke,
Und wenn man’s sieht, mir ist es einerlei;
Gib mir nur einen deiner süßen Blicke,
Wie einst im Mai.Es blüht und funkelt heut auf jedem Grabe,
Ein Tag im Jahre ist den Toten frei;
Komm an mein Herz, daß ich dich wieder habe,
Wie einst im Mai.*)
 “Auf jedem Grabe“ und “Wie einst im Mai“ nebeneinander – eine stärkere Gegensätzlichkeit der Situationen und der Empfindungen ist kaum vorstellbar. Auch hier taucht das Wort “Herbst“ nicht auf: Seiner bedarf es nicht. Wie bei Benn (siehe oben) und auch sonst ist “Aster“ das sinnliche Symbol dieser Jahreszeit.
“Auf jedem Grabe“ und “Wie einst im Mai“ nebeneinander – eine stärkere Gegensätzlichkeit der Situationen und der Empfindungen ist kaum vorstellbar. Auch hier taucht das Wort “Herbst“ nicht auf: Seiner bedarf es nicht. Wie bei Benn (siehe oben) und auch sonst ist “Aster“ das sinnliche Symbol dieser Jahreszeit.
*) International bekannt wurde Gilms Gedicht als Lied. Die Melodie hat Richard Strauss komponiert. – In ihrem Roman “Mrs Dalloway“ (1925) beschreibt die Londoner Schriftstellerin Virginia Woolf (1882-1941) den Text (der englischen Fassung) des Liedes (“Place at my side the purpleglowing heather …“). Gesungen wird es im Roman von einer alten Bettlerin. Woolf zitiert die Verse nicht wörtlich, beschreibt sie aber so genau, dass eine Verwechslung ausgeschlossen ist.
Wieder einmal soll Theodor Storm (1817-88), der Mann und Dichter aus Husum, seiner geliebten “grauen Stadt am grauen Meer“, die Umrahmung der Monatsgedichte im HDS beschließen. Während viele seiner lyrischen Kollegen noch den Abschied vom Licht des Frühlings und Sommers beklagen, sieht er schon …
HERBST
| Schon ins Land der Pyramiden Flohn die Störche übers Meer; Schwalbenflug ist längst geschieden, Auch die Lerche singt nicht mehr. |
Seufzend in geheimer Klage
Streift der Wind das letzte Grün;
Und die süßen Sommertage,
Ach, sie sind dahin, dahin!Nebel hat den Wald verschlungen,
Der dein stillstes Glück gesehn;
Ganz in Duft und Dämmerungen
Will die schöne Welt vergehn.
Nur noch einmal bricht die Sonne
Unaufhaltsam durch den Duft,
Und ein Strahl der alten Wonne
Rieselt über Tal und Kluft.
Und es leuchten Wald und Heide,
Daß man sicher glauben mag,
Hinter allem Winterleide
Lieg‘ ein ferner Frühlingstag.
P. S. Gedichte von Marita Lanfer sind an unterschiedlichen Orten veröffentlicht – meist gefühlvoll beschreibende Naturlyrik. Für die Anregung, seinen Besuchern die folgenden Verse vorzustellen, dankt das HDS der Autorin.
OKTOBER
| Schwarze Mäntel, rote Säume, Admirale, Asternträume. Fühler, Süße suchend, tunken, Wasserdost dorrt, ausgetrunken. |
Blutrot scheidet Schneeballstrauch.
Scholle glänzt nach altem Brauch.
Maiengrünes Heupferd springt.
Weidenröschensamen sinkt. Schwalben – wann sind sie gezogen?
Sacht wie Samen fortgeflogen.
Lerchenschar schwirrt auf und flieht.
Bussard ruhig Kreise zieht.
Ammernruf die Stille schlitzt,
Gold’ne Brust im Hasel blitzt.
Zweig erzittert, der sie lässt.
Stacheldraht hält Schafwollrest.